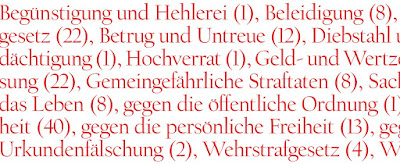-
Sie waren die Spitzenmanager der DDR, Wirtschaftsbosse und hohe Beamte mit großer Macht. Sie leiteten Zementwerke und Maschinenfabriken, reisten im Auftrag des Staates um die Welt. Heute sind ihre Lebensleistungen vergessen. Deshalb treffen sie sich in einem Berliner Café, um einander von damals zu erzählen. Und eine Antwort zu finden auf die Frage: Haben wir alles verdorben?

Foto Ina Schoenenburg
-
Es ist der Morgen ihres 16. Geburtstags, als sie sich auf den Weg macht – und spurlos verschwindet. Eltern, Freunde und Bekannte durchkämmen Berlin tagelang. Bis die schlimmste Befürchtung zur Gewissheit wird.
Erschienen im Tagesspiegel, 2.6.2018
Die Tür zu Leas Zimmer ist geschlossen, ihre Mutter hat es noch nicht wieder betreten, seit fast einem Jahr. Seit die Polizisten kamen, um zu sagen, dass sie Lea gefunden hatten. „Ich kann es nicht“, sagt sie.
-
Mindestlohn und Spitzensteuersatz, Dividende und Ostrente: In Berlin liegen Arm und Reich oft nah beieinander. Herr Nowak und Herr Kirschner wohnen seit Jahren in derselben Straße – aber in zwei Welten.
Zuerst erschienen im Tagesspiegel
In einer Auslage in der Linienstraße in Berlin hängt ein weißes Wollkleid, wolkig weich, davor ein kleiner schwarzer Zettel: „White Cashmere Dress – 468 €“.
-
Studenten protestieren in Berlin gegen den Schah-Besuch, dann eskaliert die Lage. Am Ende liegt einer blutend am Boden, mit einer Polizeikugel im Kopf. Vier Zeitzeugen rekonstruieren den 2. Juni 1967
Der Anruf aus dem Krankenhaus erreicht den SDS, Kurfürstendamm 140, abends zwischen 22 und 23 Uhr: „Ich wollte Ihnen mitteilen“, sagt der Anrufer, ohne sich vorzustellen, „dass gerade ein deutscher Student verstorben ist.“
-
Väter gegen Mütter, die Kinder dazwischen: Das Familiengericht Tempelhof- Kreuzberg, das deutschlandweit größte seiner Art, hilft den Schwächsten, wo Liebe zu Hass wurde.

Foto Mike Wolff / Tagesspiegel
Erschienen im Tagesspiegel
Erst mit der Zeit geraten im Mittendrin des Familiengerichts, zwischen An- wälten und Richterinnen, zwischen Aktenwägelchen, Gutachtern und sich zankenden Eltern, die Kinder in den Blick, um die sich hier doch fast alles dreht: schlafend im Kinderwagen die glücklichsten, die noch gar nichts von alldem rundherum begreifen. Hibbelig anhänglich andere, zwischen den El- tern hin- und herflitzend wie Boten ohne Nachricht. Betont zutraulich ein Zehnjähriger, der auf einer Bank den Kopf auf den Schoß seiner Mutter legt. Fahrig, angespannt ein Mädchen, das auf die Anhörung durch einen Richter wartet.
-
Über Kinder, die den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen. Eltern, die verlassen werden. Das Schweigen, den Schmerz, die Ratlosigkeit. Und die Chance auf einen Neubeginn

Foto: Jeff Naggy/Getty Images
Erschienen im Tagesspiegel
Rosi Prömper hat ihren Sohn verloren. Das heißt, eigentlich lebt er noch. Aber ihr ist er verloren gegangen.
-
„Der hätte doch nicht frei rumlaufen dürfen!“, heißt es oft, wenn Straftäter rückfällig werden. Doch, hätte der, findet der Berliner Bewährungshelfer Volker Schröder.
Erschienen im Tagesspiegel
Manchmal freut sich Herr Schröder, Gerichts- und Bewährungshelfer, über bestimmte Straftaten, das muss man ganz einfach mal so sagen. „Oh, ein Diebstahl, ohne Körperverletzung! Eine Beleidigung, ohne Tätlichkeit; eine Körperverletzung, aber keine schwere.“
-
Seit Jahren gibt es hier schon kein Zollhaus mehr, am Brennerpass, mitten in den Alpen. Nun will Österreich wieder einen Zaun errichten. Der soll die Flüchtlinge fernhalten - aber er entzweit Europa
Erschienen im Tagesspiegel
Am Brenner soll jetzt ein Zaun gebaut werden, ein „Grenzmanagement-Leitsystem“ auf Behörden-Österreichisch. Als hätten die ankommenden Flüchtlinge nicht schon genug mit dem Tiroler Dialekt, dem noch liegenden Schnee und der ganzen Ungeheiztheit rundherum zu kämpfen.
Der Brennerpass, dieser abgebrochene Zahn mitten im Alpenhauptkamm, ist die wichtigste Nord-Süd-Verbindung über die Alpen und der meistbefahrene Pass zwischen Italien und Österreich. An der Straße aufgefädelt stehen Bahnhof, Gasthaus, Kirche, Shoppingcenter. Autos, Züge, Lkw donnern vorbei, links und rechts steile Hänge, darüber Berggipfel.
Wird jetzt das vereinte Europa hier begraben, werden neue Grenzen, Zäune, Mauern hochgezogen? Wird der Brenner am Ende zur nächsten Station eines zerfallenden und sich abschottenden Europas: ein Calais in den Alpen, ein Idomeni in Tirol?
Am Brennerpass musste noch jeder vorbei, der nach Italien wollte: Römer, Goten, Vandalen; deutsche Kaiser, deutsche Dichter, deutsche Soldaten und deutsche Urlauber, der Brenner hat sie alle gesehen. In umgekehrter Richtung zogen italienische Gastarbeiter vorbei, Oktoberfestbesucher, Flüchtlinge.
Der Zaun, den man hier plant, gilt allein Letzteren: Weil die österreichische Regierung zusammen mit neun Balkanstaaten die Westbalkanroute geschlossen hat, stellt sie sich nun darauf ein, dass spätestens ab dem Frühsommer wieder verstärkt Flüchtende über Italien nach Norden zu reisen versuchen werden. Hauptreisezeit ist auch Hauptfluchtzeit.
Jetzt, Ende April, ist die Lage am Brennerpass ruhig, bis auf den tosenden Geräuschabfall des Personen- und Güterverkehrs: das Rauschen des Gebirgsbachs, übertönt vom Rauschen der Autobahn, akzentuiert vom Quietschen der Züge, gemischt mit den endlosen Fahrplanansagen.
Ruhig ist es hier auch, weil das Dorf Brenner langsam stirbt, seit es die Grenze nicht mehr gibt. Früher, so erzählt man sich, als noch keine Zollunion war, Österreich noch nicht in der EU, früher hätten die Geschäfte am Brenner ihre Tageseinnahmen in italienischen Lire in Plastiktüten zur Bank getragen. Jetzt wohnen hier noch kaum mehr als 300 Menschen. Wer kann, geht weg; wer kommt, der tut es, weil die Wohnungen spottbillig sind, nicht weil er hier Zukunftsperspektiven vermutet.
Das Kleidergeschäft an der Ecke hatte früher 14 Angestellte, dann tat der Chef sich schwer, allein davon zu leben. Jetzt hat er zugemacht. Die Grenzer und die Soldaten, die hier früher die Staatsgrenze schützten, sind fast alle abgezogen, der Brenner ist zum multikulturellen Einwanderungsdorf geworden: Die größte Gemeinde nach italienisch- und deutschsprachigen Südtirolern sind jetzt solche mit pakistanischen Wurzeln.
So wie Abdul, ein feingliedriger junger Mann, in Brixen geboren und seit 13 Jahren am Brenner. Er schmeißt den Imbiss gegenüber vom Bahnhof und fühlt sich am Brenner wohl. Vielleicht wäre es für seinen Laden gar nicht so schlecht, wenn die Grenze wieder zu wäre, aber er mag es sich nicht wünschen. Sein Herz ist dagegen, Zäune zu bauen. Wer flüchten muss, tut ihm leid; wer fahren will, soll fahren können.
An diesem späten Vormittag, die Sonne wärmt, der Schnee schmilzt trotzdem nicht, kauft sich am Bahnhof nur ein junger, leicht hinkender Somalier von seinen letzten zehn Euro eine Fahrkarte nach Innsbruck. Doch weit kommt er nicht, die Österreicher schicken schon jetzt immer mehr Flüchtlinge wieder zurück. Am Tag darauf kann man ihn sehen, wie er es von Neuem nach Innsbruck versucht, diesmal zu Fuß zusammen mit drei bunt verschleierten Frauen über die Staatsstraße am alten Zollhaus vorbei. Was wird er machen, wenn hier ein Zaun steht?
Die österreichische Regierung sieht sich am Limit ihrer Kapazitäten, logistisch wie auch politisch. Die beschlossene Obergrenze von 37 500 Asylbewerbern für das Jahr 2016 wurde zwar in zwei Rechtsgutachten für völkerrechts- und verfassungswidrig befunden, weil Österreich nicht einfach ab einer gewissen Zahl von Asylanträgen deren Prüfung einstellen könne. Doch sie bleibt politisch nach wie vor erklärtes Ziel.
Dies umso mehr, als der Regierung unter dem Sozialdemokraten Werner Faymann und der christdemokratischen ÖVP die offen ausländerfeindliche „Daham-statt-Islam“-Partei FPÖ im Nacken sitzt. Nachdem deren Kandidat Norbert Hofer nun die erste Runde der Präsidentschaftswahlen gewann, ist ein Sieg des Rechtspopulisten im zweiten Durchgang im Mai gut möglich. Dem Land droht ein noch gewaltigerer Rechtsruck. Die Asyl-Obergrenze ist der bislang erfolglose Versuch, den Aufstieg der Rechten aufzuhalten, indem man ihre Forderungen übernimmt.
Am Brenner zeigt sich nun: Eine Obergrenze muss nicht zwangsläufig zum Schießbefehl führen; wohl aber zum Maschendrahtzaun, zur Grenze reloaded. Italienische Zeitungen schreiben vom „muro del Brennero“, der Brenner-Mauer, und empören sich, Europa werde hier begraben. Manche fürchten allerdings weniger den ideellen Schaden als vielmehr den Umstand, dass dann alle in Italien ankommenden Geflüchteten eben dort festsitzen würden.
Die Bäckerin an der Hauptstraße hat von der ganzen Aufregung schon jetzt genug. Das italienische Fernsehen sei mehrmals hier gewesen, der Österreicher auch. „Jetzt interessieren sich auf einmal alle für uns“, sagt sie, „früher war das hier das letzte Eck.“
Seit dem Ersten Weltkrieg verläuft am Brennerpass die Staatsgrenze zwischen Italien und Österreich, zugleich zwischen dem Nord- und Südteil Tirols. Als harte Grenze zuerst, mit Zöllnern, Soldaten und Polizisten. Später wurde die immer durchlässigere Brennergrenze zum Symbol für ein immer enger zusammenrückendes Europa. 1994 verschwanden die Zollschranken, 1998 die Passkontrollen. Das Abbauen des Schlagbaums wurde als symbolische Großtat gefeiert, Sternstunde Europas.
Tatsächlich ist die Grenze hier fast unsichtbar geworden. Man schlendert zum Pizzaessen auf die eine Seite, fährt zum Tanken auf die andere, ohne dass man die Grenzüberschreitung bemerken würde. Ein junger Schulabbrecher, Spitzname Rambo, sitzt mit seinen Kumpels vor der Brenner Bahnhofsbar, erzählt, er sei hier aufgewachsen und in seinem 19-jährigen Leben noch nie an der Grenze angehalten oder kontrolliert worden.
Der alte Grenzstein ist mehr Sehenswürdigkeit denn Souveränitätsmarkierung. Im ehemaligen österreichischen Zollhaus gibt es nun Lederhosen und Tiroler Hüte zu kaufen. Geht man raus aus dem Laden, ein paar Schritte über die Straße, ist man schon in Italien. Unmittelbar vor dem Geschäft, quer über die Straße und dann steil zum Wald hinauf, verläuft seit Freitag vergangener Woche eine grellgelb auf den Asphalt gesprühte Markierung. Es ist die Vorbereitung für den Zaunbau. Am heutigen Mittwoch sollte mit den Arbeiten für Steher und Fundamente begonnen werden, sodass ein Zaun jederzeit „eingehängt“ werden kann. Gestern aber kündigte die Landespolizeidirektion Tirol an, der Zaunbau sei einstweilen angehalten, bis sich der österreichische Innenminister Wolfgang Sobotka am Donnerstag oder Freitag dieser Woche mit seinem italienischen Amtskollegen Alfano getroffen habe. Es ist ein Zugeständnis an die symbolische Wucht, die dieser Zaunbau entfaltet hat.
Am Brenner können sich nur wenige vorstellen, dass die Grenze einfach so wiederaufgebaut werden kann. Der Wirt der Bar Brenner, vis-à-vis vom Bahnhof, 500 Meter vom geplanten Grenzzaun, findet das Ganze mächtig schlecht fürs Geschäft: „Man sieht hier nichts, man kriegt nichts mit, es gibt keinen Zaun! Aber die Leute bekommen ja schon Angst, wenn sie nur die Zeitung lesen.“ Grenzkontrollen findet er richtig, „aber die Grenze zumachen, das kann sich Österreich nicht leisten: Die würden ja aushungern.“
Dabei hält Österreich mit seiner Absicht nicht hinter dem Berg; eher bezieht es noch die Berge in eben diese mit ein. Eine Mauer steht ja schon hier, links und rechts, aus Glimmerschiefer und Gneisen: die Ostalpen. Und ein Gipfel nicht weit entfernt trägt den Namen „Hoher Zaun“. Auch wenn es offiziell noch heißt, das „Aktivieren des Grenzmanagements“, das „Einhängen des Zaunes“ werde nur erfolgen, wenn es dafür Bedarf gebe, wenn es nötig sei, weil keine europäische Lösung existiere, wenn die Zahl der aus Italien nach Norden reisenden Flüchtlinge wieder ansteige, wenn Italien nicht die nötigen Maßnahmen ergreife, um die Flüchtlinge aufzuhalten, bevor sie überhaupt zum Brenner kommen. Aber wenn, dann. Dann wäre man gerüstet.
Bis Mitte Mai war es hier auch im vergangenen Jahr ruhig, bis die Flüchtlingszahlen über Nacht stark anstiegen und dann den ganzen Sommer hindurch 200, 300 und mehr Menschen am Tag ankamen. Am Ende haben alle nur noch improvisiert.
Weil Österreich eine Wiederholung auf jeden Fall vermeiden will, hat man beschlossen, am Brenner eine Infrastruktur des „Grenzmanagements“ zu errichten: eine Kontrollstation aus Zaun und Zelt, dazwischen ein Leitsystem, durch das die Ankommenden an einer Registrierungsstelle vorbeigeschleust werden.
Einreise oder Zurückweisung, die Abfertigung soll im Schnelldurchlauf erfolgen, dazu würden die Ankommenden sich wegen der gewundenen Bahnen ständig in Bewegung befinden und nicht das Gefühl des Stillstands bekommen. Bis sie dann, immer noch in Bewegung, am anderen Ende des Grenzmanagements ausgespuckt werden, mit dem Bescheid, ihr Asyl anderswo, jedenfalls nicht hier, zu suchen.
Auf dem Parkplatz hinter dem alten Zollhaus, wo die Registrierungsstelle gebaut werden soll, steht jetzt noch ein Schild, „Fluchtweg freihalten“. Das wird man dann wohl wegräumen.
Überhaupt „Grenzmanagement“. Ein Name mit guten Aussichten auf den Titel als Unwort des Jahres. Lenkwerkzeug von Flüchtlingsströmen, Schalthebel der Menschen-Logistik. Rechtlich flankiert wird der Maschendraht mit einer Notverordnung, die das österreichische Parlament am Mittwoch beschließen soll: die „Sonderbestimmung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und des Schutzes der inneren Sicherheit während der Durchführung von Grenzkontrollen“, mit der die österreichische Regierung sich ermächtigt, einen Notstand zu erklären, und das Recht auf Asyl, wie es bisher galt, faktisch abzuschaffen.
Ab 1. Juni 2016 können dann, wenn es die Regierung für notwendig erachtet und die von ihr festgesetzte Obergrenze von Asylbewerbern erreicht ist, alle weiteren zurückgewiesen werden, sofern sie nicht schwanger, minderjährig und unbegleitet sind oder mit jemandem verwandt oder verheiratet, der bereits in Österreich Schutz genießt. Oder in Italien von Folter oder Abschiebung bedroht sind, und dies auch im Schnellverfahren glaubhaft gemacht werden kann. Alle anderen, so heißt es bei der Baubesprechung für den Grenzzaun, würden entweder wieder auf die Straße gestellt oder „dem Italiener“ übergeben, wenn dieser sich denn dazu bereit erkläre. Das wisse man aber noch nicht. Tatsächlich prescht Österreich einseitig vor, in Bezug auf eine Grenze, die doch per Definition eine zweiseitige Angelegenheit ist.
Simon Schieferer, Geschäftsführer des Rosenberger-Autobahn-Restaurants auf der gegenüberliegenden Talseite, ist nicht erfreut: Das Grenzmanagement sei auch für ihn „eine Reise ins Ungewisse“. Seine Raststätte, die an der Stelle der alten österreichischen Autobahngrenzstation gebaut wurde, muss die Sommersaison mit halbiertem Parkplatz angehen. Weil sich die Republik Österreich die andere Hälfte für eine Inspektionsstelle der nach Österreich reisenden Autos und Lastwagen reserviert hat. Gerade werden dort die Leitplanken der Autobahn weggeflext, damit das Fundament für ein Dach, Ausweichroute, Kontrollstation gebaut werden kann. „Vierspurig wird man dann hier im Stau stehen“, meint Schieferer, „wer kommt da noch zu uns herein?“
Dabei ist man am Brenner den Stau wahrlich gewöhnt, vor allem an jenen Wochenenden im Sommer, wenn gefühlte halbe Bundesländer sich auf den Weg machen, nach Rimini, an den Gardasee, auf die Berge in Südtirol. Das Rosenberger ist so gebaut, als sei die Grenze für immer ein Ding der Vergangenheit: Drinnen hängen wandgroße Fotografien der Grenznostalgie, Polaroids der Zeitgeschichte. Wo früher die italienische Grenzstation, der Schlagbaum, die Zöllner standen, wird jetzt Kaffee serviert, die Salatbar bestückt. Toilettenbesuch 50 Cent.
Widerstand regt sich indes auch am Brenner. Am vergangenen Sonntag fordern Demonstranten ein Niederreißen der Grenzen und verlangen zugleich, man müsse sich jetzt entscheiden, auf welcher Seite man stehe.
Eine Verkäuferin eines der Geschäfte erzählt, sie habe an der Zaunbaustelle zugesehen, wie da gemessen wurde und markiert und kartografiert, die Staatsgrenze bis auf den Zentimeter genau von der Karte auf die Wirklichkeit übertragen, und dann ein Grenzschild aufgestellt, als Markierungspunkt. In einem unbemerkten Augenblick sei sie vorbeigegangen und habe das Schild mit dem Fuß verschoben. Österreich hat gut zehn Zentimeter Territorium eingebüßt, ein geschrumpftes Land seitdem.
-
Vor fünf Jahren musste in Berlin ein Dutzend Häftlinge aus der Sicherungsverwahrung entlassen werden. Verbrecher, die als extrem gefährlich und rückfallgefährdet galten. Mit ihrer Resozialisierung ist der Stadt ein kleines Wunder gelungen
(Erschienen im Tagesspiegel)
Gutachter und Gerichte waren sich einig: Frank Peters* sei gefährlich, befanden sie, gewalttätig und unverbesserlich. Weshalb er weggesperrt gehöre, in Sicherungsverwahrung, am besten für immer.
Heute verabredet sich Frank Peters im Café und trinkt entspannt seinen Latte wie all die anderen um ihn auch. Muskelbepackt, braungebrannt und rasiert sitzt er da, den V-Rücken ins knappe T-Shirt gepresst. Seine Tätowierungen bedecken beide Arme bis zur Schulter mit schwarz geritzten Zeichnungen: einst Teil einer Knastuniform, Fantasie-Orden eines Gefängnisgenerals. Heute fällt er damit in Berlin nicht mehr groß auf.
Peters ist Anfang 50, seit fünf Jahren wieder frei. Erster Eindruck: Typ harte Schale, einen versuchten Mord und einen Totschlag in der Akte. Einer der erzählt von seinem „Stand“ im Knast, vom Hauen und Stechen unter den Gefangenen, die über einen wie Wölfe herfielen, wenn man sich nicht wehre. Aber auch: Typ weicher Kern. Als seine Freundin ihn später im Café abholen will, schicken sie sich verliebt Luftküsse hin- und her.
Peters saß in Sicherungsverwahrung (SV), weil ein Gutachter ihn für gefährlich erklärt hatte, für rückfallgefährdet und nicht entlassbar. Doch dann entschied im Dezember 2009 der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass es nicht rechtens sei, ihn länger einzusperren. Die rückwirkende Verlängerung der Sicherungsverwahrung - von vormals zehn Jahren auf unbegrenzte Zeit - sei genauso menschenrechtswidrig wie die nachträgliche SV, also wenn die „Haft nach der Haft“ nicht schon mit dem Urteil, sondern erst nach Verbüßung der Gefängnisstrafe verhängt wird.
Peters und elf weitere Häftlinge, der jüngste 42, der älteste 78 Jahre alt, mussten in Berlin zwischen Februar 2011 und Anfang 2012 entlassen werden. Ein „Skandalurteil“ für manche. Groß war die Aufregung, noch größer die Verunsicherung. „So gefährlich sind die sieben Schwerverbrecher, die Berlin jetzt freilassen muss“, schrieb die „Bild“-Zeitung damals, und präsentierte die ersten sieben zu Entlassenden mit Kurzbiografien, ihre Vorstrafen katalogisiert: Der Frauenmörder. Der Mädchenschänder. Der Sex-Täter. Der Vergewaltiger. Der Totschläger. Der Würger. Der Kinder-Jäger.
Und dann?
Hat man von den Entlassenen nicht mehr viel gehört. Einer von ihnen ist ziemlich schnell rückfällig geworden, hat im Suff eine Geldtasche geklaut und jemanden getreten. Er sitzt seitdem wieder im Knast. Vier sind inzwischen gestorben. Doch die anderen leben unauffällig ihr Leben in Freiheit. Bei vielen ist jetzt selbst schon die fünfjährige Führungsaufsicht zu Ende.
Bedeutet das also, dass Peters und die anderen Entlassenen geläutert, bessere Menschen geworden sind? Oder heißt das, dass sie gar nicht so gefährlich waren, wie ihnen Gutachter und Gerichte immer und immer wieder attestiert hatten? Oder sollte es Berlin wirklich gelungen sein, das Rückfallrisiko dieser Kindermörder und Gewaltverbrecher drastisch zu senken - durch die Vorbereitung der Entlassungen, die Therapien und anfängliche Überwachung? Dann wäre den Behörden etwas Unerhörtes geglückt.
Tatjana Voß, die Leiterin der Forensisch-Therapeutischen Ambulanz der Charité, hat die zwölf Männer begleitet, hat sie analysiert, betreut und überwacht, „forensisch rehabilitiert“, nennt sie das. Voß, mittellange braune Haare, Brille, sitzt in ihrem Büro in einem Backsteinhaus gleich neben der Justizvollzugsanstalt Tegel und lächelt freundlich, sie könnte auch als Gymnasiallehrerin durchgehen. Die Psychiaterin sieht jeden Tag in menschliche Abgründe. Aber sie schafft es, dass ihr dabei der Mensch um den Abgrund herum nicht aus dem Blick gerät.
Tatjana Voß sagt: „Es gab schon einen sehr großen politischen Willen, das gemeinsam hinzubekommen.“ Alle Beteiligten hätten sich regelmäßig getroffen, und ein in Deutschland bislang beispielloses Projekt aufgebaut, unter Federführung der Senatsverwaltung für Justiz, der Führungsaufsichtstelle, des Landeskriminalamts (LKA) und der Forensisch-Therapeutischen Ambulanz. „Da wurde sehr viel Personal und Zeit investiert und zusammen überlegt: Was braucht der Mensch? So entstand dann ein Bild des Einzelnen mit seinen Stärken und seinen Schwächen.“ Dazu kam, dass Voß und ihr Team acht Monate Zeit hatten, um die Entlassungen vorzubereiten, und mit den SVlern ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. „Es gab Männer, die das Angebot dankbar aufgenommen haben“, sagt Voß, „und andere, die mich aus dem Haftraum wieder rausgeschmissen haben, gesagt haben, das passiert eh nicht, gehen Sie mir fort mit Ihrem Therapiekram.“
Auch Frank Peters glaubte nicht daran, dass man ihn tatsächlich entlassen würde: „Zuerst bist du die Bestie, der Schlimmste von überall, den man nie wieder rauslassen wollte, und dann setzen sie dich vor die Tür.“
Nach und nach ist es Tatjana Voß doch gelungen, mit allen ins Gespräch zu kommen. „Vielleicht weil ich eine Frau bin, weil ich Ärztin bin, weil ich sage, ich unterstütze Sie, wir reden nicht über Ihre Delikte.“ Stattdessen fragte sie, wie sich die SVler das Leben in Freiheit vorstellen würden, was sie arbeiten, ob sie alleine wohnen wollen oder in einer WG. „Klar, man war am Anfang ein bisschen bange, wenn man die Akten gelesen hatte, aber wenn man dann davor saß, waren es eben keine Monster. Sie haben schreckliche Taten begangen, aber es sind Menschen.“
Menschen, die Jahrzehnte hinter Gittern verbracht hatten. Und nun kam auf einmal Frau Voß, und suchte nach Stärken, nach Lebenszielen, arbeitete mit Empathie, mit Lob und Anerkennung für jeden noch so kleinen Erfolg. In einer Studie schreiben die Therapeuten über Entlassungen: „Dies ist bei langjährig untergebrachten Patienten kein leichtes Unterfangen und dafür oft umso wirksamer.“
Und umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, wie sehr manche der zwölf zu Entlassenden in der Haft verwahrlost waren. Einer von ihnen, Günther Hauk, hatte mehr als 40 Jahre im Gefängnis gesessen, nachdem er in den 60ern eine Bekannte erwürgt und dann während eines Hafturlaubs in den 70ern eine weitere Frau und ihren Sohn getötet hatte. Nach 14 Jahren in Sicherungsverwahrung, ohne Perspektive, jemals wieder freizukommen, verließ er seine Zelle auch am Tage nicht mehr, rasierte sich nicht mehr, wusch sich nicht mehr.
Selbst ihn hat das Berliner Projekt wieder eingegliedert. Am Ende habe er, der dreifache Totschläger, in seinem Zimmer im Altenheim gesessen, so erzählt es eine seiner Betreuerinnen, in dem gemütlichen roten Sessel, den er sich von der Haftentschädigung gekauft hatte, und habe zufrieden gesagt: „Mensch, ich sterbe in Freiheit!“ Nur zwei Jahre nach seiner Entlassung hatte man ihn aus der Obhut seiner Therapeuten entlassen und ihm beschieden: „Herr Hauk, Sie sind gut angekommen, alle kennen Sie, alle mögen Sie, Sie nehmen an der Singgruppe teil, Ihre Enkeltochter kommt Sie besuchen: Wir lassen Sie von jetzt an in Ruhe.“ Günther Hauk ist dann wirklich im Altersheim gestorben.
Frank Peters lebt jetzt seit fünf Jahren außerhalb der Gefängnismauern, ohne dass er sich etwas hat zuschulden kommen lassen. Er ist angekommen in seinem neuen Leben, auch wenn es am Anfang nicht leicht war. Zum Beispiel vor dem Arbeitsamt, da hatte er ein bisschen „Panik“ vor: „So mehr aus dem Fernsehen, ich dachte mir: Wie soll ich mit dem Arbeitsamt klarkommen, wenn schon die Leute draußen manchmal durchdrehen?“
War aber dann in echt viel unproblematischer als im TV, und drei Wochen später hatte er einen Job gefunden. „Im Knast haben die ja nur darauf gewartet, und gesagt, das kann nicht gut gehen.“ Es ging aber gut, und es geht, bis heute, gut. Peters hat Arbeit, hat eine Wohnung, er hat mit dem Alkohol Schluss gemacht und lebt seit mehreren Jahren in einer Beziehung. Damit das auch so bleibt, besteht sein Anwalt darauf, dass Frank Peters anonym bleiben kann.
Die Sicherungsverwahrung, die Haft nach der Haft, schon in den 20ern diskutiert als Ersatz für die Todesstrafe, und eingeführt im November 1933 durch das „Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher“, ist das schärfste Instrument des Strafrechts überhaupt.
In Berlin waren es im Jahr 2015 insgesamt 44 Menschen, die „sicher verwahrt“ wurden. Weil man ihnen nach Paragraf 66 Strafgesetzbuch einen „Hang“ attestiert hatte, „zu erheblichen Straftaten, namentlich zu solchen, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden“.
Wem ein solcher Hang bescheinigt wird, der kann auf Jahrzehnte weggesperrt werden. Auch das kostet: 139 Euro zahlt Berlin für jeden einzelnen Hafttag eines SVlers. Dieser wird erst dann entlassen, wenn seine Gefährlichkeit nachgelassen hat. Beides, sowohl die Gefährlichkeit als auch ihr Abklingen, muss von forensisch-psychiatrischen Gutachtern festgestellt werden, deren Prognose in den meisten Fällen als Grundlage für die Gerichtsentscheidung dient.
Natürlich gehört gutachterlicher Mut dazu, zu sagen: Herr X. ist harmlos, lasst ihn gehen! Wenn man nicht hundertprozentig sicher sein kann. Und sollte Herr X. sich an neuen Opfern vergehen, dann würde ja der Gutachter als Erster an den Pranger gestellt.
Bei den zwölf Entlassenen in Berlin hatte kein einziger Häftling eine positive Prognose. Trotzdem gab es bei zehn von ihnen laut Therapeuten „eine - angesichts der jeweiligen Vorgeschichte - erstaunlich problemlose Integration“.
Lag es an den Therapiestunden, dass die Resozialisierung so gut funktioniert hat? Oder daran, dass die Männer so alt und von der Haft so zermürbt waren, dass sie gar nicht mehr imstande waren, Verbrechen zu begehen? Lag es an Tatjana Voß, die, als einer der Entlassenen, verzweifelt und zur Freiheit nicht mehr fähig, wieder eingesperrt werden wollte, sich hinstellte und sagte: „Das geht leider nicht, Sie sind jetzt frei. Und Sie schaffen das!“
Das erste Jahr in Freiheit gilt als das kritischste, da geschehen die meisten Rückfälle. Das Risiko gilt als geringer, solange die Ex-Häftlinge in einem Heim oder betreuten Wohnprojekt leben. Die Ex-SVler mit einer „klaren Störung der Sexualpräferenz“ wurden zusätzlich medikamentös behandelt. Manche kommen bis heute freiwillig zu den Therapeuten, andere setzen ihre Behandlung beim Hausarzt fort. Dass dies auch ohne Aufsicht geschieht, zählt zum Restrisiko. Denn es ist ja nicht so, dass es bei den „Langzeitlern“ nicht zu Rückfällen kommt. In Berlin wurden während der Zeit, als die zwölf Männer nach den Urteilen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte freikamen, noch 15 andere Sicherungsverwahrte regulär entlassen. Drei davon wurden rückfällig, wenn auch mit Delikten, die alleine die Sicherungsverwahrung nicht rechtfertigen würden: eine Schlägerei, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine gefährliche Körperverletzung. Und in Düsseldorf, im Jahr 2011, missbrauchte ein Sexualstraftäter, der aus der Sicherungsverwahrung kam, nach sechs Monaten ein Mädchen; da war seine Überwachung durch die Polizei bereits gelockert worden, weil er als „kooperativ und vertrauenswürdig“ galt.
Der Kriminologe Michael Alex hat in einer Studie die Rückfallquote anhand von 131 Gefangenen erforscht, bei denen Gutachter die Sicherungsverwahrung gefordert hatten, sie aber wegen der Urteile der höchsten Gerichte nicht mehr verhängt werden konnte. Sein Ergebnis: Bei unvorbereitet Entlassenen ohne Nachsorge gibt es eine Rückfallquote von ungefähr 15 Prozent. Das heißt, dass die meisten Sicherungsverwahrten zu Unrecht für immer weggeschlossen bleiben. „Sie werden mit den 15 Prozent über den gleichen Kamm geschoren.“
Entscheidend für einen Rückfall sei der „soziale Empfangsraum“, in den der Entlassene zurückkehre. „Den aber kann der Gutachter im Knast ja überhaupt nicht beurteilen.“ Der damals erzwungene Berliner Modellversuch habe gezeigt, „dass das Risiko viel geringer ist, und praktisch auf null reduziert werden kann, wenn die Entlassenen nur entsprechend begleitet werden“.
Auch Frank Peters musste nach seiner Entlassung einmal die Woche zur Forensisch-Therapeutischen Ambulanz, Alkohol- und Drogenkontrolle, außerdem gab es für ihn gleich zwei Bewährungshelfer bei der Führungsaufsicht, und einmal im Monat musste er im LKA vorsprechen.
Überwachung und Unterstützung, Mentoring und Monitoring - davon hatte Peters allerdings bald die Schnauze voll. „Als würde ich mit dem Messer mang die Zähne auf die Straße rennen und die Leute abstechen!“ Zumal er Arbeit hatte und sich nicht jedes Mal freinehmen konnte, um von einem Therapeutentermin zum nächsten Behördentermin zu tingeln.
Hätten die Gutachter und Gerichte ahnen können, dass Peters sich in den ersten fünf Jahren so entwickeln würde? Einer dieser Gutachter ist Hans-Ludwig Kröber, Direktor des Instituts für Forensische Psychiatrie an der Charité und einer der prominentesten Kriminalprognostiker Deutschlands. Er hatte mehrere der Berliner Entlassenen schon begutachtet, als sie noch in der SV saßen, und sie danach in Freiheit mit betreut. Waren seine vormaligen Gutachten, die den Verwahrten eine fortwährende Gefährlichkeit attestiert hatten, falsch?
Zumindest habe ihn der Berliner Modellversuch überrascht, sagt Kröber. Er habe zuvor nicht geglaubt, dass es so gut laufen würde. „Wir haben mit hoher Geschwindigkeit ein Helfer- und Kontrollnetz um die zu Entlassenden gebaut“, sagt der Psychiater, und es habe sich gezeigt, dass bei diesen Männern - mit einem ganz erheblichen Aufwand an auch aufsuchender Betreuung und Krisenintervention - „relevante kriminelle Rückfälle“ verhindert werden konnten, sofern keine massive Alkoholproblematik vorlag. „Das Ganze war aber alles andere als ein Spaziergang.“
Kröber sagt selbst, er habe durch das Modellprojekt „viel dazugelernt“, nicht nur über die Nachsorge von Entlassenen, sondern für Prognosegutachten von Straftätern überhaupt. Vor allem dies: Maßnahmen innerhalb des Vollzugs schafften allenfalls, das Rückfallrisiko von 100 auf 50 Prozent zu senken. Es auf nahe null zu bringen, schaffe nur „eine engagierte ambulante Weiterbetreuung über mehrere Jahre“. Man müsste also vorher wissen, ob es draußen eine Einrichtung geben wird, die jemandem wie Frank Peters dabei hilft, „die Füße stillzuhalten“, wie Peters das selber nennt, auch wenn es vorher „nicht meine Art war“. Und Menschen, die ihm helfen, lebenslang vom Alkohol die Finger zu lassen.
Dann kommt Peters Freundin, um ihn nach dem Interview im Café abzuholen. Er sei ein ganz Lieber, sagt sie, nett und allen gegenüber zur Hilfe bereit. Und vielleicht jetzt einfach endlich erwachsen geworden.
Stolz ist sie auf ihn, und darauf, dass er auf sich selbst stolz sein kann.
* Namen der Ex-Häftlinge geändert -
Der BND hat seine Zentrale in der Chausseestraße noch nicht richtig bezogen. Doch die Nachbarn im Kiez fragen sich schon jetzt: Überwachen die auch uns? Ein Observationsprotokoll
Erschienen im Tagesspiegel, 22.08.2015
Beginn Observation, 12. Juni, 12.30 Uhr, Standort Chausseestraße, Ecke Wöhlertstraße, BND-Nordbebauung
Die neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes glänzt metallen in der Sonne, die Gebäudeflügel aufgereiht wie Steckkarten. Immer neue Module immer gleicher Fenster, Stockwerk um Stockwerk, Rechteck um Rechteck. Über fast 300 Meter zieht sich das Hauptgebäude die Chausseestraße entlang.
Sommerhitze, Mitte-Betriebsamkeit, Baulärm: Schlapphüte sind keine auszumachen, kein Trenchcoat zu sehen. Woran soll man die Geheimdienstler denn dann erkennen? 170 BNDler sind seit 2014 schon hier am Werk. Wie wird das erst sein, wenn die restlichen der 4000 Mitarbeiter aus Pullach bei München in ihre neue Berliner Zentrale gezogen sind?
„Die sind doch schon hier“, sagt X (Name geschwärzt), Wirt eines Restaurants, das ein paar hundert Meter vom BND-Bau entfernt liegt. „Und man sieht sie auch. Kommen drei Herren im Anzug, süddeutscher Akzent, und alle drei bestellen zum Mittagessen ein großes Hefeweizen. Wer soll das denn sonst sein?“
Die Pullacher kommen! Nach Mitte. Nach Ost-Berlin. In ein Berlin, das es noch nicht gibt, ein Berlin, das verschwindet, in ein neues, das gerade erst entsteht.
Wie fühlt sich das an, wenn Deutschlands einziger Auslandsnachrichtendienst mitten ins Wohnviertel zieht? Ein Geheimdienst zumal, der bis vor Kurzem noch ganz im Verborgenen agierte, der erst vor einem Jahr bei sechs seiner Außenstellen die bis dahin geführten Tarnnamen wie „Ionosphäreninstitut“ oder „Amt für Schadensabwicklung“ durch „BND“ ersetzte? Und der aus den Schlagzeilen nicht herauskommt?
Auslandsspionage: Der BND im rechtsfreien Raum +++ Was Sie über Selektoren wissen müssen +++ De Maizière sieht Schuld „hundert Prozent“ beim BND +++ Geheimdienstaffäre: BND horchte seine eigenen Leute aus +++ Überwachung: BND beauftragt CIA-Firmen +++ Mit wem trinkt der BND jedes Jahr auf dem Oktoberfest?
Der BND selbst verbindet mit dem Umzug aus der vormaligen „Reichssiedlung Rudolf Heß“ in Pullach im Isartal, wo er seit 1947 sitzt, nicht nur das Ziel, näher an Bundesregierung und Parlament zu rücken, sondern auch eine Demonstration von Transparenz, von Öffentlichkeit: Einen „BND zum Anfassen“ versprach Präsident Gerhard Schindler beim Teilbezug der Nordbebauung durch 170 BND-Mitarbeiter im März 2014.
Fortsetzung Observation, 14. Juni, 11.40 Uhr, Standort Chausseestraße, Ecke Schwartzkopffstraße
Frau Czerny hatte früher Sonne, jetzt hat sie den BND vorm Balkon. „Die Leute sagen zu mir: Na, jetzt wohnst du aber sicher“, erzählt sie. „Ich denke mir: Vielleicht aber eben gerade auch nicht.“
Frau Czerny, genau doppelt so alt wie das wiedervereinigte Deutschland, findet es „schon ein bisschen herb, dass so eine Geheimdienstzentrale mitten in die Stadt hineingebaut wird, so ein Riesending dazu“.
Wann immer man sich angesichts der Nachrichtenlage fragt, wer eigentlich die Überwacher überwacht und den Spionen hinterherspioniert, so gibt es eine Gewissheit: Auf Frau Czerny ist Verlass. Sie tut, woran sich das Parlamentarische Kontrollgremium die Zähne ausbeißt: Sie sieht dem BND auf die Finger, behält sein Treiben im Auge, überwacht den Geheimdienst.
Das heißt, eigentlich nicht sie selbst, sondern der Plastikspion in Lebensgröße, den sie zwischen den Pelargonien auf ihrem Balkon platziert hat: eine Puppe vom Flohmarkt, original mit Schlapphut und Trenchcoat, das Fernglas auf die BND-Zentrale gegenüber gerichtet.
Der Plastikspitzel ist so etwas wie Frau Czernys Antwort auf die Baustelle gegenüber. Darauf, dass man ihr „so einen Kasten“ vor die Haustür setzt.
Dabei ist Frau Czerny, wie übrigens die meisten der zukünftigen Nachbarn des BND, überzeugt, dass der Geheimdienst sie bereits unter die Lupe genommen hat. „Wir wurden doch sicher alle schon mal durchgecheckt“, sagt sie. „Um zu gucken, ob wir weiter hier wohnen dürfen.“
Einmal sei auch jemand gekommen, der sich die Namen auf den Briefkästen notiert habe. Gewissheit hat Frau Czerny keine, Beweise oder so, dafür dass sie durchleuchtet worden wäre. Sie hat nur die diffuse Überzeugung, dass die das doch bestimmt machen würden.
Wie die Überwachung im Großen hinterlässt auch die mutmaßliche Überwachung im Kleinen eine abstrakte Versehrtheit, ein Gefühl von Machtlosigkeit.
Vielleicht ist Frau Czernys Spion auf dem Balkon denn auch so etwas wie ein Experiment. Um zu gucken: Reagiert da jemand? Melden die sich?
„Ich habe mir gedacht, vielleicht verbieten die mir das“, sagt Frau Czerny. „Aber bis jetzt habe ich noch nichts gehört.“
Quellenbefragung, 17. Juni, 10.52 Uhr, Telefonat mit der Pressestelle des Bundesnachrichtendienstes, Frau Y (Name geschwärzt)
Frau Y, wie wird sich der BND als neuer Nachbar im Kiez verhalten? Werden Sie sich vorstellen? Laden Sie die Leute ein? Was planen Sie, wenn Sie jetzt neu ins Viertel ziehen?
„Ich kann Ihnen da jetzt nichts Zitierfähiges zu sagen (...) Sie dürfen mich jetzt nicht zitieren (...) aber wie gesagt, das können Sie alles nicht zitieren (...) im Augenblick können wir uns dazu nicht offiziell äußern.“
In Pullach durften doch die BND-Mitarbeiter nicht im Dorf wohnen, wie wird das denn in Berlin-Mitte sein?
„(...) aber auch das bitte jetzt nicht zitieren.“
Wenn Sie als Geheimdienst irgendwo einziehen, würde ich mir als Laie vorstellen, dass Sie als Erstes mal genau prüfen, wer da drum herum so wohnt.
„(...) noch mal die Bitte, mich nicht zu zitieren in irgendeiner Weise (...)“
Danke für das Gespräch.
Die Geheimen bleiben also geheim, trotz der beim Teileinzug in die neue Zentrale ausgerufenen „Transparenzinitiative“. Welche bei einem Nachrichtendienst auf enge Grenzen stoßen muss, besteht doch sein eigentliches Geschäft im Geheimen, im Nicht-Transparenten.
So bleibt ein Rätsel, eine Leere. Die Leere aber füllt sich sogleich mit Mutmaßungen und Gerüchten, mit Beobachtetem, Behauptetem, Zusammengereimtem.
Und mit Literatur.
Archiveinsicht, 18. Juni, 18.45 Uhr: der BND als Motiv im B-Movie und im Agentenroman
Sein Name war Urban, Bob Urban. Von 1965 bis 1992 war Urban alias „Mister Dynamit“ als BND-Agent im Dienst: durchtrainiert, ein Ass im Steuern schneller Autos, im Konsumieren großer Mengen harten Alkohols, im Verführen von Frauen, deren Beine nicht enden wollen. Ein Westentaschen-James-Bond mit Maschinenbaustudium und Penthouse in München-Schwabing.
In mehr als 300 Folgen jagte ihn sein Schöpfer C. H. Guenter alias Karl-Heinz Günther über das dünne Papier der Groschenhefte, in schnell rausgehauenen Reißern, gespickt mit Dialogen voller abgedroschener Schlagfertigkeit, Altherrenwitzen, Kaltem Krieg.
Genau wie bei James Bond stehen auch bei Mister Dynamit die „Girls“ bloß auf dem Buchdeckel im Vordergrund („blondes Gift“), oft bewaffnet, selten bekleidet, während sie im Plot Beiwerk sind, nebensächlich, immer dann beiseitegeschoben, wenn es brenzlig wird.
Wie Bond schaffte auch Bob Urban den Sprung auf die große Leinwand, in „Morgen küsst euch der Tod“ aus dem Jahr 1967. Beim BND mag man damals gehofft haben, dass nun auch der Dienst glamourös und sexy sein würde, zumal Agent Urban von Lex „Old Shatterhand“ Barker gespielt wurde.
Doch der Film wird ein Flop, ein Reinfall ohne Fortsetzung. Der BND bleibt prosaisch, grau, versteckt, das Mauerblümchen unter den internationalen Geheimdiensten.
Vielleicht auch deshalb denken viele Nachbarn im Kiez nicht als Erstes an James Bond, wenn sie an den BND-Neubau denken. Sondern eher an einen großen Computer. Eine steinerne Hauptplatine, eine Modulsammlung von immenser Bit-Kraft, ein Großspeicher.
Bob Urban, scheint es, hat sich zum Netzwerkadministrator umschulen lassen.
Dabei zieht ausgerechnet jene Abteilung des BND, deren täglich Brot die Überwachung von Datenströmen ist, gar nicht nach Berlin. Die „Technische Abteilung“ bleibt in Pullach und in anderen Außenstellen.
Meldedienstliche Verschlusssache, Nachrichtenauswertung 8. Juni: Farbbeutelanschlag auf den BND
In der Nacht auf den 8. Juni werfen Unbekannte mehrere Farbbeutel an die Fassade des BND-Neubaus. Am 8. Juni folgt ein Bekennerschreiben mit der Überschrift „Friede den Hütten, Krieg den Palästen!“ Die unbekannten Beutelschleuderer schreiben: „Eine der hässlichsten Fratzen der deutschen Außenpolitik ist seit jeher der Bundesnachrichtendienst (BND). Während die Bundeswehr mittlerweile laut die Werbetrommel für den Krieg rührt, agiert der BND dagegen verdeckt durch eine Politik der Angst und Kontrolle, in der alle Menschen potenziell zu Feinden erklärt werden. Auch wenn unsere Farbklekse (sic) das massenhafte Überwachen und Bespitzeln nicht beenden können, setzen sie ein buntes Zeichen auf die grauen Fassaden der angsteinflößenden Architektur des BND in der Chausseestraße.“
Fortsetzung Observation 24. Juni, 14.50 Uhr, Standort Chausseestraße Ecke Schwartzkopffstraße
Bauhelme statt Schlapphüte. Direkt gegenüber vom BND baut Stararchitekt Daniel Libeskind ein Eckwohnhaus, einen „Saphir“. Es ist ein aufgeschnittener, zerbrochener Bau, dessen scharfe Kanten und schiefe Zacken ihn wie einen geschliffenen Stein aussehen lassen. 70 Wohnungen sollen es werden, vom Penthouse zum „Small Apartment“, vier Stockwerke Rohbau stehen schon.
Die computergenerierten Visualisierungen der Titanfliesenfassade verheißen ein Gleißen und Schimmern, das im Marketingmaterial als „Funkeln eines Edelsteins“ umschrieben wird, rar und kostbar, sprich: teuer.
Dabei hat der Architekt das eigentlich gar nicht so gemeint. Für Libeskind, den Architekten des Jüdischen Museums, der hier sein erstes Wohnhaus in Deutschland baut, ging es erst einmal ums Licht. Und darum, Wohnraum zu schaffen, „worin die Menschen am Morgen mit Freude aufwachen, wohin sie am Abend mit Freude zurückkehren“. Darum, ein Haus zu bauen, das „das Viertel mit Leben erfüllt“.
Wofür er nicht nur Begeisterung erntet. Unter den zukünftigen Nachbarn des „Sapphire“ erzählt man sich, Libeskind habe bei der Besichtigung des Baugrunds gesagt: „Dann werden wir hier mal ’ne anständige Straße draus machen.“ So, als wohnte hier noch niemand, als gäbe es hier noch nichts.
Wahrscheinlich hat Libeskind das gar nicht so gesagt, erstens. Und zweitens hätte er natürlich Recht damit, dass links und rechts der Chausseestraße bis vor Kurzem noch sehr viel Leere und Lücke war. Dass die Bombentreffer des Zweiten Weltkriegs hier Ruinen hinterließen, dass große Teile der Fabriken und Wohnhäuser der Oranienburger Vorstadt in Trümmern lagen und auch zu Ost-Berliner Zeiten nicht wiederaufgebaut wurden.
Und dass erst heute, 70 Jahre nach Kriegsende, die Bombenruinen beseitigt, die Brachen bebaut werden.
Aber liegt nicht am Ende das Wesen Berlins in den Narben der Geschichte, den Spuren der Verwüstung? Und verschwindet nicht auch ein Stück Berlin, wenn jetzt Neubauten die letzten Bombenlücken füllen?
Für Daniel Libeskind ist das Nostalgie. „Bauen muss man, auch dort, wo zerstört wurde. Aber bauen mit Gedächtnis, Erinnerung, mit einem Bewusstsein der Vergangenheit.“
Und was heißt es für ihn, unmittelbar neben dem BND zu bauen, in Sichtweite eines Geheimdienstes? „Man kann sich seine Nachbarn nicht aussuchen“, sagt Libeskind. Es klingt politisch, ist aber eher ästhetisch gemeint. Für ihn sei die BND-Zentrale in erster Linie „ein großes, ein wirklich großes Gebäude“, so der Architekt. „Aber du musst die Ecke, wo du bist, zu deinem Vorteil ausnutzen.“ Mach was draus, mach das Beste draus! Jetzt klingt der Architekt vor allem pragmatisch.
„Vom ,Sapphire‘ aus wird man eine ganz neue Sicht auf die BND-Zentrale haben, die sehr interessant aussehen wird. Und wenn sich die Gegend entwickelt und mit mehr Leben erfüllt, wird die BND-Zentrale in den Hintergrund rücken. Jetzt ist sie bloß im Vordergrund, weil sie so neu ist.“ Vielleicht wird Libeskind recht behalten. Eines Tages wird man dann sagen: das Sapphire-Viertel. Und nicht: der Kiez der Spione.
Fortsetzung Observation, 23. Juni, 14 Uhr, Standort Chausseestraße, Ecke Schwartzkopffstraße
Der BND kommt nach Hause. Nach Ost-Berlin.
Bis 1990 lag die Chausseestraße, wo der BND nun einzieht, in der DDR, sie gehörte für den BRD-Auslandsnachrichtendienst zum Ausland, war Arbeitsfeld, Spionageziel.
Heute gibt es nicht mehr viele, die schon „zu Ost-Zeiten“ im Viertel wohnten. Einen noch, vielleicht, in jedem Haus. So wie Herrn Ewald aus der Wöhlertstraße, der mit dem Langhaardackel. Herr Ewald, der zu Ost-Zeiten Raupenfahrer war, der, inzwischen über 80, die Barthaare vereinzelt und verloren am Kinn, einen Audi fährt, genauso alt wie das wiedervereinigte Deutschland, aber deutlich jünger aussehend, „weil da die Karosserie verzinkt ist, da rostet nichts“. Herr Ewald, der sonst an wenig und wenigen ein gutes Haar lässt. Bei ihm haben „die da oben, auf Deutsch gesagt, alle verschissen“.
Herr Ewald ist die Nachhut eines Ost-Berlins, das es bald nicht mehr geben wird. Er ist einer der Letzten, die hier friedlich, still und leise verdrängt werden, bis sie irgendwann auf einmal weg sein werden, verschwunden.
Der BND ist Herrn Ewald von Grund auf egal. Und als er schließt, zieht er ein Fazit, das nicht nur für dieses Gespräch gilt, sondern vielleicht auch für all die vergangenen Jahre. „Aber wat soll’s.“
Fortsetzung Observation, 23. Juni, 14.30 Uhr, Standort Chausseestraße, Ecke Schwartzkopffstraße
Was bleibt? Ein Stück DDR gibt es noch, das lebt hier weiter, unbeschadet, überschattet zwar, aber aufs Bleiben eingerichtet. Von Herrn Ewalds Haus einmal die Pflugstraße runter, dann rechts rein, direkt vis-à-vis vom Haupteingang des BND steht es, neben Libeskinds „Sapphire“: ein Block Genossenschaftswohnungen, vierstöckig, mit Geranien auf den blau-weißen Balkonen, für Ost-Berliner Polizisten gebaut.
Früher war 300 Meter von hier Richtung Wedding die Sektorengrenze, später die Mauer, Grenzübergang Chausseestraße.
Keiner wohnte in der Genossenschaft, der nicht bei der Polizei oder bei der Feuerwehr war, staatstreue Bürger der Deutschen Demokratischen Republik.
So wie Herr Fischer, Hans-Joachim, der 1953 Polizist wurde, ja, 1953, nach dem 17. Juni, oder eigentlich deswegen.
Heute sagt man ja „Volksaufstand“ dazu, hat Herr Fischer nichts dagegen.
Er aber sah damals, „wie alles kaputtgeschlagen zu werden drohte, was man gerade erst aufgebaut hatte“, in Stalinstadt, heute Eisenhüttenstadt.
Und als Fischer am 17. Juni, als FDJler, der er war, angesprochen wird, „ob er mithelfen würde, Ruhe zu schaffen“, da hilft er, drei Tage lang, im Krad-Wagen-Einsatz, mit Flüstertüte und vorgeschriebenem Text.
Dabei will er eigentlich Tischler werden, hat seine Lehre gerade abgeschlossen. Erst beim dritten Anwerbeversuch gibt er nach und wird doch Polizist, die Republik braucht Polizisten, „wegen der Sektorengrenze und für die ganzen Posten“.
Und weil Polizisten auch wo wohnen müssen, baut man ihnen 1956 die Genossenschaft an der Ecke Schwartzkopff-/Chausseestraße.
Fischer bleibt Polizist, auch als er wegen seiner in den Westen gegangenen Eltern und Geschwister Schwierigkeiten bekommt, er bringt es bis zum Polizeioffizier, trotz Westverwandtschaft. Zur Wende, nach 36 Jahren Polizei, ist er Major und lässt sich just zum Tag der Einheit in den Vorruhestand versetzen.
Jetzt ist das ja alles vorbei, Geschichte, aber wie war das hier früher, zu Ost-Zeiten? Wie lebte man hier, wie wohnte man? Die Chausseestraße, „das war eine ganz ruhige Ecke, da war fast alles zertrümmert“, sagt Herr Fischer, „noch dazu war der Kiez ein vorgeschobener Winkel Ost-Berlin“, an drei Seiten von der Mauer umschlossen.
Wenn jetzt der BND gegenüber einzieht, dann verliert Herr Fischer „eigentlich weiter nichts als die schöne Lage“, sagt er. „Wir haben hier fast wie im Bungalowdorf gewohnt, überall Grün rundherum.“
In Fischers Haus galt damals der niedrigste Mietspiegel Ost-Berlins, die DDR-Mietpreishandbremse voll angezogen: „Die Wohnung kostete 1959 beim Einzug 26,20 Mark, und 30 Jahre später, beim Mauerfall, immer noch genau gleich viel.“
Gegenüber, wo jetzt die BND-Zentrale entsteht, war früher das Stadion der Weltjugend, die „Zickenwiese“, vorher Walter-Ulbricht-Stadion, dessen Bart dem Gelände den Namen gab.
Vom Dach auf Herrn Fischers Haus konnte man da zugucken, wenn im Stadion Fußball gespielt wurde. Jeder Zehntklässler aus Mitte musste dort antreten, um die Sportprüfung abzulegen.
Zum BND, einst „gegnerische Organisation“, will Herrn Fischer partout nichts Negatives einfallen. Denn: „Jeder Staat hat ja seinen Sicherheitsapparat. Und der ist bis zu einem hohen Grad auch tatsächlich nötig.“
Auch Herr Fischer ist überzeugt, dass er und seine Nachbarn durchleuchtet wurden. Daran stößt er sich aber nicht. Er kennt das von früher, alle hier denken beim Thema Überwachung als Erstes an früher. Herr Fischer zum Beispiel hatte zu Ost-Zeiten, als Polizist, bloß ein Diensttelefon, „da wussten alle, dass das abgehört wurde“, die Staatssicherheit eben.
Etwas hat ihn beim BND aber schon ein bisschen überrascht: „Dass sie wussten, wer ich bin.“
Herr Fischer war, wie alle Anwohner, zur Baueröffnung eingeladen, „aus informativen Gründen“, erinnert er sich. „Nach den Hinweisen auf die Beeinträchtigungen durch den Bautransport hob ich gleich als Erster meine Hand: Warum man nicht den Bautransport über den Spandauer Kanal per Schifffahrt durchführt? Könnte man ja bis auf 300 Meter zur Baustelle alle Materialien heranschaffen.“
„Tja, dann fangen Sie mal an, Herr Fischer“, sagte da der Diskussionsleiter vom BND. „Der kannte mich also persönlich, obwohl ich den noch nie vorher gesehen hatte.“
Wie kann das sein? Kann das überhaupt sein? Fischer breitet die Arme aus, er lächelt, beredtes Schweigen. Er würde es auch nicht glauben, wenn er es nicht selbst erlebt hätte.
Trotzdem, für ihn hat das schon eine gewisse Logik, dass der BND nun genau hier einzieht, an der Chausseestraße: „Das war ja früher auch schon ein Kasernengrundstück. Maikäferkaserne, bevor das Stadion gebaut wurde. Wenn die jetzt wieder eine Kaserne da hinbauen wollen, bitte sehr.“
Betreff: Maikäferkaserne, heute BND-Südbebauung, Chausseestraße, Ecke Habersaathstraße, 23. Juni, 15.30 Uhr
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor. Steht keine Laterne, Überwachungskameras sind jetzt davor.
Ein ganzes Jahrhundert ist vergangen, seit im April 1915 der Lehrer und Gardefüsilier Hans Leip Wache schiebt, hier vor der Maikäferkaserne in der Chausseestraße, kurz bevor er nach Russland an die Front soll.
Er kritzelt ein paar Gedichtzeilen auf seinen Notizblock, nennt sie „Lied eines jungen Wachpostens“: „So woll’n wir uns da wiedersehn, bei der Laterne woll’n wir stehn, wie einst Lili Marleen.“
Wo damals das vornehme Garde-Füsilier-Regiment seine Garnison hatte, wo einst Lili Marleen stand, da werden bald Nachwuchsagenten hinter rotem Klinker die Geheimdienstschulbank drücken. Die BND-Südbebauung wird hier stehen, mit öffentlich zugänglichem Besucherzentrum.
Hans Leip wird im Krieg verwundet, überlebt und hat einigen Erfolg als Schriftsteller und Grafiker. Sein Lied „Lili Marleen“ wird erst 1939 von der Chansonnière Lale Andersen aufgenommen, und nach seiner Verbreitung durch den Soldatensender Belgrad zum Zweite-Weltkriegs-Hit.
An die Garde-Füsiliere erinnert allein noch der Namenspatron der Straße an der Südseite des BND-Baus, Erich Habersaath: Werkzeugmacher war er, Metallarbeiter in der nahe gelegenen Maschinenfabrik Schwartzkopff, als er 26-jährig während der Novemberrevolution 1918 beim Sturm auf die Kaserne von einem Offizier erschossen wurde.
Auch erinnern an die Füsiliere noch die prunkvollen Überreste des preußischen Offizierskasinos im Haus gegenüber, Chausseestraße 36, wo sich vielleicht auch jener konterrevolutionäre Offizier verlustierte, der Habersaath erschoss. Stuck, Parkett und Marmor haben zwei Weltkriege und 40 Jahre DDR fast unbeschadet überstanden. Heute: Fotogalerie, Salon für Geschäftsevents, Luxuswohnungen.
Sonst wurde fast alles zerstört. Die Fabriken, die Wohnhäuser dazwischen, die Kaserne. Steht keine Laterne mehr davor.
Fortsetzung Observation, 23. Juni, 16.20 Uhr, Standort Chausseestraße 37–60
Jetzt legt sich eine neue, ganz andere Stadt über die alte, die Brachen werden gefüllt, das Gewesene verschwindet.
Auf den 400 Metern, die das BND-Gelände entlang der Chausseestraße einnimmt, wird an allen Ecken und Enden gebaut. „Developed“ wird Berlin hier, entwickelt, mehr als 1000 Wohnungen werden geschaffen, zugleich eine neue Sprache erfunden, eine neue Welt.
„The Garden Living“, 120 Eigentumswohnungen, 160 Mietwohnungen „für Stadtmenschen, die gefühlte, behagliche Lebensqualität mit dem hohen Pulsschlag der Metropole verbinden wollen“ (Chausseestraße 57–60).
„Be part of it! The Mile“, 270 Wohnungen „im Lifestyle-Zentrum der Stadt“, für alle Lebenssituationen „von urbanen Kosmopoliten bis zu mobilen Managern, Single, Paar oder Familie, Wohnen auf Zeit oder als langfristiges Zuhause“ (Chausseestraße 37).
Die Feuerlandhöfe, 400 Wohnungen rund um die Reste einer Bromsilberfabrik, in „einer der zukunftsträchtigen und gefragtesten Lagen Berlins“ (Chausseestraße 38–42a).
Und natürlich der „Sapphire“, 70 Wohnungen, „ein neues Juwel: ein Architekturlandmark“ (Chausseestraße 43).
Noch wohnt hier niemand, keine Menschen jedenfalls, sondern bloß die computergenerierten Figuren aus den Prospekten der Developer. Frauen in kurzen Kleidern, Männer im Freizeitdress oder von der Arbeit kommend, Kinder, Tag und Nacht beim Spielen.
Auf Hochglanz wird hier eine neue Stadt heraufbeschworen, gerendert, mit der Poesie von Designprogrammen und Grafikkarten erzeugt.
Allein die Tanke am Ende der BND-Meile, an der Ecke Chausseestraße/Liesenstraße, ist ein letzter Hinweis darauf, dass hier Grenze war, Mauerstreifen, billiges Niemandsland. Wenn auch sie verschwindet, dann wird die Brachenzeit, in der sommers die Gräser kniehoch wachsen, sirrend, zukunftslos, endgültig zu Ende sein.
Aber Frank Hackethal, Wirt im „Hackethals“ und Anwohner in der Pflugstraße, ein paar hundert Meter von alldem entfernt, mag nicht gegen etwas sein, an dem er nichts ändern kann. Sein ganzes Leben hat er hier im Kiez gewohnt, in der Wöhlert-, in der Pflugstraße, Sportprüfung auf der Zickenwiese. Seit fünfzehn Jahren führt er das Hackethals in der Pflugstraße („Wir kochen selbst – Kommen Sie trotzdem!“).
Jetzt wird sein Kiez durchgewirbelt, bis zur Unkenntlichkeit verändert. Verschwindet da nicht irgendwas, wenn jetzt alle Brachen ... ?
„Im Gegenteil!“, sagt Hackethal. „Zu DDR-Zeiten waren alle Fassaden gleich, an jedem Haus der gleiche graue Putz, alle Ruinen blieben liegen. Jetzt wird Berlin wieder so, wie es früher einmal war.“
Fortsetzung Quellenbefragung: Fischer, Hans-Joachim, 23. Juni, 17.10 Uhr, Standort Chausseestraße, Ecke Schwartzkopffstraße
Herr Fischer, Hans-Joachim, Major der Volkspolizei im Ruhestand, der nach dem 17. Juni 1953 Polizist wurde oder eigentlich deswegen, ist die Ruhe selbst. Dabei sitzt er im Auge des Wirbelsturms, der seine Straße erfasst hat.
„Berlin wird nun tatsächlich Europastadt“, stellt er fest. Und rechnet eigentlich damit, dass seine Genossenschaft irgendwann mit weggeweht wird. „Wenn diese Entwicklung so weitergeht wie bisher, dann nehme ich an, dass unsere Häuser auch nicht bleiben können. Die könnten ja die Genossenschaft dann einfach wegexperimentieren. Oder aber man freut sich darüber, dass wenigstens noch ein Haus hier stehen geblieben ist, das einen grünen Vorgarten hat.“
Vielleicht ist jetzt der Augenblick gekommen, zu fragen, ob nicht vielleicht hier im Haus noch ein BND-Gegenspieler von damals wohnt? Ein Ostspion, einer von Markus Wolfs Männern vielleicht, Hauptverwaltung Aufklärung, dem Auslandsnachrichtendienst des MfS?
„Da gab’s mal einen, der war bei der Stasi. Der ist erst Mitte der 1960er eingezogen. Da wussten wir, dass er bei der Staatssicherheit war, und zwar im Abwehrdienst. Aber der ist tot. Sonst kenne ich keinen weiter hier, der diese Richtung hätte.“
Quellenbefragung Z (Name geschwärzt), 25. Juni, Chausseestraße 56, Blick auf Nordbebauung BND
Treffpunkt Café Jadore, der Nachfolger des „Top Secret Café am BND“. Letzterem, einem von mehreren kommerziellen Frühstarts hier in der Gegend, hat die mehrjährige Verspätung des BND-Umzugs den Garaus gemacht.
Quelle Z, 36, kommt pünktlich. Kurz gestutztes Haar, Karohemd, Selbstgedrehte.
Z hatte „früher viel mit dem BND zu tun“, arbeitet jetzt „im Sicherheitssektor“.
Wie ein Präsentierteller liege die neue BND-Zentrale mitten im Wohnviertel, sagt Z. Gut möglich, dass gegnerische Dienste versuchen werden, alle Gesichter der Ein- und Ausgehenden abzufilmen, digital zu erfassen.
Z geht davon aus, dass „der Dienst“ deshalb und sowieso alle Wohnungen mit Sicht auf den BND durchleuchten müsse, zur eigenen Sicherheit.
Es ändern sich die Assoziationen, wenn einer „viel mit dem BDN zu tun“ hatte. Z überlegt, ob und wie und wann die BND-Zentrale selbst zum Anschlagsziel werden könnte, malt sich Flugbahnen von Panzerabwehrgranaten aus, Autobombenszenarien. Ein vorbeifahrender Schäferhund im Lastenfahrrad sieht in seinen Augen „wie ein Kabuler Sprengstoffhund“ aus.
Aber: Das größte Sicherheitsrisiko sei immer noch der unzufriedene BNDler selbst. Der übergangene, unterschätzte, gemobbte Geheimdienstler, der Spion, der innerlich gekündigt hat. Denn auch beim BND menschele es.
„Und es wird sicher auch mal vorkommen“, sagt Z, „dass einer nach dem achten Weizen seinen Laptop oder eine Aktentasche mit geheimen Unterlagen in der Kneipe oder der U-Bahn liegen lässt.“
Fortsetzung Observation, 25. Juni, 18.40 Uhr, Ida-von-Arnim-Straße
Ein Wagen der Carsharing-Firma DriveNow parkt in der abgeriegelten Ida-von-Arnim-Straße, BND-Nordbebauung, hinter Schranke und bemannter Sicherheitsbarriere. Jeder Benutzer kann den Wagen online buchen. Abholen können ihn nur BND-Mitarbeiter und Bauarbeiter mit Zugangsberechtigung.
Fortsetzung Observation, 11. Juli, Standort Edward-Joseph-Snowden-Platz
Der BND ist noch nicht wirklich da, aber einen Edward-Snowden-Platz gibt es schon.
Jeden Samstag demonstriert hier ein Grüppchen Unentwegter, Gegner der „Überwachung aller Kommunikation“, der „illegalen Praktiken“ des BND, den sie „an die Kette legen“ wollen.
Sie wissen, dass sie recht haben, dass sie für die vielen sprechen. Und dass sich von den vielen fast keiner zu ihnen gesellen wird.
Wie die gefühlte Überwachung im Kleinen hinterlässt auch das Bewusstsein der Überwachung im Großen, Globalen eine abstrakte Versehrtheit, eine Ahnung von Machtlosigkeit.
Genug immerhin, um jeden Samstag für ein paar Stunden einen Platz nach dem Geheimdienstrenegaten Edward Snowden zu benennen, einen richtigen kleinen Platz mit Baum und Häuserwand und blau-weißem Straßenschild, Liebesgrüße aus Moskau, an der Südseite des BND.
Die Unentwegten sind auf Dauer eingerichtet, jeden Samstag wollen sie sich hier treffen, auf absehbare Zeit, darauf vertrauend, dass der BND auch in Zukunft nicht aus den Schlagzeilen herauskommen wird.
BND muss Selektorenliste nicht an Presse herausgeben +++ Beeinflusst BND-Mann für Russen NSA-Ausschuss? +++ BND-Chef Schindler: „Gut, dass wir mit NSA kooperieren“ +++ Welches Spiel treibt der BND? +++ BND-Spion stahl brisantere Dokumente als bislang bekannt +++ Kontaktpflege des BND: Vier Maß für die Herren Agenten! +++ Solidaritätswelle mit netzpolitik.org: Noch immer laufen BND-Schlapphüte frei herum.
Fortsetzung Observation, 17. Juli, 19.20 Uhr, Standort Chausseestraße 54
Im Hostel 54 sind alle Zimmer restlos belegt, 365 Tage im Jahr. Gäste aus aller Herren Länder wohnen hier, aus allen Schichten, Junge, Alte, Familien mit Kindern. Es sind Asylbewerber, zur Vollpension, mit Kostenübernahme vom Amt: Das Hostel ist zum Flüchtlingsheim umfunktioniert worden.
Der Herr am Empfang trägt Anzug und Krawatte, wie früher, Touristeninformationen zu Berlin und seinen Sehenswürdigkeiten liegen aus. Doch der Rezeptionist verteilt jetzt vor allem Post von Gerichten und Ämtern, Asylbescheide, Vorladungen, Ablehnungen. Trinkgeld bekommt er keines mehr.
Draußen spielen die Kinder, so wie Kinder früher überall spielten: auf der Straße, mit Vorgefundenem, mit anderer Leute Fahrrad, unbeaufsichtigt, laut, bis jemand sie verscheucht.
Heute ist der erste Tag des Eid al-Fitr, des Fastenbrechens am Ende des Ramadan.
Da schüttelt fast jeder Asylbewerber-Hotelgast dem Herrn am Empfang die Hand, man tauscht Glückwünsche auf Arabisch aus, dreimal, viermal geht das hin und her, bis es am Ende in einem Murmeln verklingt.
Ein Syrer, Elektriker von Beruf, überlegt, ob man ihn hier in Deutschland bei der Feuerwehr nehmen würde. Sein Cousin ist doch auch schon bei der Polizei.
Geheimdienste kennt er aus Syrien zur Genüge, alles Schreckliche haben sie den Leuten dort angetan. Den BND vor der Tür, direkt gegenüber, findet er weniger bedrohlich. Wirklich wichtig, wirklich mächtig, sagt er, sei doch der Inlandsgeheimdienst. Nicht der fürs Ausland.
Ende Operativer Vorgang, 18. Juli, 18.05 Uhr, Standort Chausseestraße
An allen Ecken des noch leeren BND-Gehäuses, an der Umzäunung, zur Straße hin in regelmäßigen Abständen, hängen Bündel von Überwachungskameras, aufgefächert, jeden Winkel filmend.
Dahinter werden irgendwann, bald, auf Schirme starrende Sicherheitsmänner sitzen, schlecht bezahlte, Tag und Nacht werden sie Ausschau halten, zu unser aller Sicherheit. Dabei dürfen die Kameras laut Gesetz nur den unmittelbaren Außenbereich des Gebäudes im Blick haben, nicht ins Viertel hinausschauen, nicht verfolgen, was hier sonst noch passiert.
So werden sie nicht sehen, wie hier alles noch im Fluss ist, im Entstehen, sie werden nicht mitbekommen, wie sich die Häuser bald mit Leben füllen werden.
Die Bedeutung der Architektur, den Sinn der Stadt, sagt Daniel Libeskind, schaffen erst jene, die darin wohnen, darin leben, sie beleben.
So wie Herr Ewald, der mit dem Langhaardackel. So wie Herr Fischer, der sich, inzwischen 80-jährig und „immer noch ein politischer Mensch“, doch am BND nicht stört.
So wie Frau Czerny und ihr Spion am Balkon, der zurückspioniert, den BND im Auge behält.
So wie all die, die einmal hier wohnen werden, deren Kiez es sein wird, Kosmopoliten, Asylbewerber, Manager, Familien. Geheime, Heimliche und Unheimliche, Überwacher und Überwachte. Dazwischen Agenten. Und solche, die Agentenromane bloß lesen. -
Arabische Musik hat in Berlin keinen Ort: keine Akademie, keine Philharmonie, kein Konservatorium.
(Erschienen in 128 - Magazin der Berliner Philharmoniker)
In dem musikalischen Garten Berlins ist die arabische Musik eine Pflanze, die unerwartet wächst: Zwischen den anderen Sträuchern, am Rande der Beete geht sie auf, ein Gewächs aus herbeigewehten Samen, deren Nährstoff aber die Liebe zur Musik ist.
Mohamed Askari ist ein solcher Musik-Liebender
-
Eine Begegnung mit John Berger vor seinem 88. Geburtstag
John Berger kann vor Rückenschmerzen kaum sitzen noch laufen. Doch mag er keinen Wein eingeschenkt bekommen, bevor nicht alle anderen am Tisch versorgt sind. Es ist nicht Höflichkeit, nicht affektiert; es scheint vielmehr, als sei es ihm ganz unmöglich, seinen Wein zu genießen, wenn nicht alle anderen auch welchen bekommen.
So blitzt, für einen Augenblick, in seiner resoluten Aufmerksamkeit für alle Tischgenossen, für die Gleichheit ohne Unterschied von Alter oder Renommee, jene Einheit von Poetischem und Politischem auf, jenes Spiegeln des Weltumspannenden im Allerkleinsten, die auch sein Schreiben beleben.
John Berger ist Schriftsteller und Kunstkritiker, er zeichnet, schreibt Romane, Gedichte, politisch-philosophische Pamphlete, Theaterstücke. Wenn er schreibt, wird noch das Alltäglichste mit einer Innigkeit aufgeladen, dass es zu leuchten beginnt: Eine Operation am Grauen Star führt zu einem Buch über das Glück des Sehens, das Motorradfahren zur Meditation über das Zeichnen, jede Reise, Begegnung, jeder Verlust zu einem neuen Buch, einer Zeichnung, einem Essay.
Dabei verschwimmt die Grenze zwischen Kunst und Leben, und es ist unmöglich, sich auszumalen, wie John Berger Feierabend machen könnte vom John-Berger-Sein: Nein, er trinkt genau so, wie er schreibt, wie er beklagt, besingt und protestiert. Und er meint es ernst, wenn er vor dem öffentlichen Zwiegespräch mit seiner Übersetzerin Maria Nadotti sagt, nicht auf seine Äußerungen käme es an, sondern allein darauf, welche Gedanken sie in seinen Zuhörern bewirkten, was jene daraus machten. Es ist keine rhetorische Geste der Schmeichelei vor dem Publikum, sondern eine Spiegelung desselben radikalen Impulses, der ihn vor fast 40 Jahren vom Booker-Prize-Gewinner und Kunstkritiker zum Bergbauern werden ließ.
„Als ich zusammen mit dem Fotografen Jean Mohr beschloss, ein Buch über Arbeitsmigranten in Europa zu machen, über Portugiesen, Italiener“, erzählt Berger, „ging es vor allem darum, zuzuhören, was diese Männer erlebten, und dann zu versuchen einen Ausdruck dafür zu finden, was sie erlebt hatten, und warum sie dazu genötigt wurden, es zu erleben. Fast alle stammten aus Familien von Kleinbauern, und wenn sie über ihre Kindheit und ihre Jugend sprachen, verstand ich, dass das alles jenseits meiner Vorstellung war, so ein Leben, mit seinen ganz eigenen Nöten. Und plötzlich erschrak ich darüber, dass ich davon so gar nichts wusste. Zu jener Zeit lebte mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung als arme Kleinbauern, und ich hatte keine Ahnung davon. Also beschloss ich, etwas dagegen zu tun. Und nachdem ich eine Weile darüber nachgedacht hatte, entschied ich mich, in die französischen Alpen zu ziehen, ziemlich hoch hinauf, zu hoch für die industrielle Landwirtschaft, in mitten von Bergbauernfamilien.“
Vielleicht ist dies Bergers Talent? Über die eigene Ignoranz derart zu erschrecken, und dann eine existenzielle Entscheidung daran zu knüpfen? Aus jenem Entschluss, das Leben der Einfachsten und Ärmsten zu teilen, verband sich auch ein ästhetischer Schwenk des Erzählens vom ‚ich’ der frühen Romane zur dritten Person: „Dort (in dem kleinen Dorf Quincy in Haute-Savoie, Anm. PE) gab es alte Leute, Männer und Frauen, unter denen ich zu leben begann, und die mir gegenüber aufgeschlossen waren, und denen ich zuhörte. So begann ich, mit der Stimme der anderen zu schreiben. Und seitdem habe ich das beibehalten. Aus dem Bewusstsein meines Unwissens, und dem Bedürfnis, etwas dagegen zu tun.“
Seitdem hat John Berger mit der Stimme eines streunenden Hundes erzählt (King, Hanser), eines Häftlings und seiner Geliebten (A und X, Hanser), mit der des Philosophen Spinoza (Bentos Skizzenbuch, Hanser) oder jener der savoyischen Bergbauern, unter denen er lebt (SauErde, S. Fischer).
Nun liegt dies nicht etwa daran, dass Berger nicht ‚ich’ zu sagen vermag, oder sich in den Stimmen der anderen zu verstecken versucht. Natürlich ist es er, der den anderen seine Stimme leiht. Doch liegt ihm nichts ferner, als seine eigenen Befindlichkeiten zum Thema zu machen. Dies mag auch der Grund sein, dass Berger sich scheut, Interviews zu geben. Zu wenig präzise ist ihm das gesprochene Wort. Auf jede Frage antwortet er mit einem erzählerischen Schlenker, „a little story“, welche eben nicht: eine Antwort auf eine Frage gibt, sondern: einen Zusammenhang erleuchtet.
Etwa auf die Frage nach der Sprache als Heimat, nach der Muttersprache als Behausung für einen, der – in London geboren - sich heute als “nationslos“ bezeichnet: „Haben Sie bemerkt“, fragt er, „wenn Sie einen Baum betrachten, eine Birke, eine Eiche, ganz gleich welchen Baum, und dann eines seiner Blätter ansehen, haben Sie bemerkt, wie der Baum als ganzer versucht, in seiner Form jene des einzelnen Blattes nachzuahmen? Und wenn ich darüber nachdenke, dann möchte ich den Baum zeichnen, und der Zeichnung den Namen „Eichen-Baum-Text“ geben - Text, nicht Zeichnung. Denn es ist eine Frage der Botschaft, einer genetischen Botschaft in diesem Baum, und das gleiche gilt für fast alle Naturphänomene. Ich vermute also, dass es eine Verbindung gibt - allerdings müssen Sie das selbst herausfinden, weil ich nicht sicher bin, wie sie am besten ausgedrückt werden kann, - dass es eine Verbindung gibt, zwischen dieser Art von Text und Mutter-Sprache. Vielleicht ist das ganze Universum eine Mutter-Sprache.“
Eine typisch Bergersche Miniatur, nicht esoterisch vernebelnd, sondern materialistisch-romantisch, der seismographischen Wahrnehmung verschrieben. Unzeitgemäß dazu, doch würde er dies zweifellos als Auszeichnung verstehen.
Genauso unzeitgemäß antwortet Berger auf die Frage, was er, der so viel über die Fotografie geschrieben habe, von der rasanten Vermehrung und Allgegenwärtigkeit digitaler Bilder halte, von dem Umstand, dass wir nun alle digitale Fotografen geworden sind. Noch einmal „a little story“: “Vor dreißig Jahren schrieb ich eine Serie von Liebesgedichten, und ich wollte, dass jedes Gedicht auch eine fotografische Entsprechung habe, ein Landschaftsbild. Also lernte ich zu, wie man eine Kamera bedient, und Fotos schießt. Ich machte meine Bilder, und veröffentlichte das Buch, und auch danach fuhr ich für etwa zweieinhalb Jahre fort, zu fotografieren. Doch auf einmal hörte ich auf, und verschenkte meine Kamera. Warum? Ich habe aufgehört, weil ich entdeckte, dass das Fotografieren mich davon abhielt, etwas lang genug zu betrachten. Ich betrachtete, und dann: „Klick“. Vielleicht wollte ich „Klick“ nicht. Vielleicht wollte ich noch eine Stunde länger betrachten. Und seither habe ich keine Kamera und ich fotografiere nicht mehr.“
Als Antidot zum Fotografieren dient Berger das Zeichnen: Es ist kein Beenden des Betrachtens, sondern sein Werkzeug, seine Steigerung. Und es ist ein Erkenntnisinstrument seiner Philosophie der allereinfachsten Dinge: des Kriechenpflaumenbaumes vor seinem Haus, einer Schwertlilie, einer Hand. Stufenlos erwächst Berger aus dem Sehen, dem Betrachten der Welt, eine Politik: Er sieht das Furchtbare in dieser Welt, und das Schöne darin; das Schreckliche, das Menschen anderen Menschen antun, und die Verhältnisse, die es ermöglichen. Trotzdem, oder genau deswegen, hält Berger an der Hoffnung fest, seiner politisch-poetischen Fassung von Hoffnung:
„Hoffnung ist wie die Flamme einer Kerze; sie ist in der Dunkelheit wichtiger denn bei Tag. Doch, so scheint mir, ist die Nahrung dieser Flamme nicht eine optimistische Sicht der Zukunft, ganz im Gegenteil: Zuerst und vor allem ist es die Treue zu den Toten, zu dem, worauf sie hofften, was sie erlitten, was sie erkämpft haben. Hoffnung ist verbunden mit dem Gefühl der Komplizenschaft mit anderen, unzähligen anderen: Mit den Lebenden, den noch Ungeborenen und den Toten, die alle gleichermaßen anwesend sind. Und es ist gerade die Gleichheit in dieser Anwesenheit, an der sich die Hoffnung entzündet.“ -
Im Westjordanland liegt Gewaltlosigkeit im Auge des Betrachters.
Wenn die Dorfjugend von Ni’lin nach dem Freitagsgebet zwischen Ölbäumen und blühenden Kakteen ihre Steinschleudern ausprobiert, während ein paar Dutzend ältere Einwohner in der Mittagshitze Fahnen schwingen und Parolen skandieren, dann gilt dies hier als friedliche Kundgebung.

(Zuerst erschienen im Handelsblatt)
-
Zum achten Mal finden am 25. Mai Wahlen zum Europaparlament statt, die ersten Wahlen, nachdem die EU in der Eurokrise knapp am Auseinanderbrechen vorbeischrammte. Ein Gespräch mit dem französischen Philosophen Étienne Balibar, der die Widersprüche der europäischen Integration immer wieder kritisiert, aber dabei stets für eine linke pro-europäische Position eintritt.
Herr Balibar, was hat die Eurokrise aus Europa gemacht? Ist Europa noch zu retten?
Die gegenwärtige Krise, die als globale Finanzkrise begann, und dann zu einer europäischen Banken- und Staatsschuldenkrise wurde, hat gezeigt, dass das europäische politische System nicht im Stande war, auf die wirtschaftliche Herausforderung demokratisch zu reagieren. Im Gegenteil, die Europäische Kommission und die europäische Zentralbank versuchten und versuchen, eine Art von autoritärer Legitimität außerhalb demokratischer Prozesse zu erzeugen und ihre Politik durch eine Revolution von Oben durchzusetzen. Zu deren Auswirkungen gehören die institutionellen Widersprüche der EU, die riesigen Diskrepanzen zwischen den verschiedenen Ländern der EU, und nicht zuletzt die gravierenden sozialen Auswirkungen der Politik, mit der versucht wird, der Krise Herr zu werden. Was früher die Teilung in Ost und West war, ist heute ein scharfer Abgrund zwischen Süd und Nord, zwischen Gläubigernationen und Schuldnerstaaten. Die Frage ist nur: Wie groß kann der Abgrund, das „Wohlstandsgefälle“ werden, ohne dass die EU auseinander bricht? Ich glaube nicht, dass diese Widersprüche mit dem derzeitigen politischen Instrumentarium Europas aufgelöst werden können.
In der Krise hat sich Europa als brutale Maschine der Strukturanpassung erwiesen: In Griechenland, Italien, Spanien, sogar in Frankreich wird im Namen Europas umstrukturiert, privatisiert, werden Löhne gekürzt, Sozialleistungen beschnitten, Arbeitnehmerrechte wegreformiert...
Ja, natürlich, aber das ist nur eine Seite der Medaille. Und wenn Sie ausschließlich auf diese eine Seite blicken, dann landen Sie unmittelbar bei dem sehr verbreiteten Anti-Europäismus, der - auf verstörende Weise – von Leuten auf der radikalen Linken und radikalen Rechten geteilt wird. Wir sollten diesen Aspekt - die EU als neoliberale Strukturanpassungsmaschine - auf keinen Fall verleugnen, aber wir müssen ihn in einen größeren Zusammenhang setzen, und die europäische Integration als historischen Prozess betrachten, um ihre inneren Widersprüche zu sehen.
Was ist für Sie das Gefährliche an einer derart ‚einseitigen‘ Europakritik?
Ich bestehe auf der Wichtigkeit einer globalen Perspektive, und weigere mich, mich zwischen dem blinden Verfechten des europäischen Projekts, vor allem wie es sich derzeit entwickelt, und einer rein anti-europäischen Position entscheiden zu müssen. Letztere spielt im Endeffekt dem Nationalismus in die Hände, den es heute in allen Ländern Europas gibt, und der eigentlich nur selbstzerstörerische Wirkung haben kann. Der Ausweg ist, darauf zu bestehen, dass es Alternativen gibt. Nun kann man sagen, dass diese Alternativen, die ich aufzeichne, sehr hypothetisch sind, oder davon abhängen, dass sich die sozialen und politischen Kräfteverhältnisse in Europa ändern, was im Moment nicht sehr wahrscheinlich ist. Und natürlich ist meine Sicht der Dinge eher pessimistisch, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Krise sich nicht verschlimmern wird.
Was bedeutet das für die EU-Wahlen, die im Mai abgehalten werden sollen? Das Europäische Parlament hat ja seit dem Vertrag von Lissabon etwas mehr Mitspracherecht.
In der Tat, das EU Parlament wird zum ersten Mal beim Präsidenten der EU-Kommission ein Veto haben und ich denke, dass das keine Nebensächlichkeit ist. So wie sich die Dinge heute darstellen, gibt es mehrere wahrscheinliche Szenarien: Einmal kann es natürlich sein, dass sich gar nichts ändert. In den letzen EU Wahlen gab es eine Tendenz sinkender Wahlbeteiligung, weil die WählerInnen eben nicht davon überzeugt waren, dass die Wahlen irgendwelche Auswirkungen haben können. Nun, diese Ansicht werden sie nicht ablegen, nur weil ein paar institutionelle Modifikationen angekündigt worden sind.
Wie schätzen Sie den anti-europäischen Populismus ein ? Für das politische Establishment ist er eine Irritation, eine Herausforderung, die einerseits als irationell abgetan wird, aber andrerseits den Finger in die Wunde der EU legt.
Ich denke, dass wir damit beginnen sollten, den sehr konfusen Begriff des „Populismus“ in Frage zu stellen. Viele Politiker und Politologen verwenden den Begriff im Wesentlichen dazu, eine Politik zu disqualifizieren, die die Massen mobilisiert und die Interessen der Armen vertritt, und um den Eindruck zu erzeugen, dass die „extreme Rechte“ und die „extreme Linke“ auswechselbar sind. Was grundfalsch ist. Aber natürlich kann die zunehmende Verzweiflung eines großen Teils der Bevölkerung zu einem Erstarken der extremen Rechten und des Nationalismus zu führen, wenn die Demokraten ihr nicht Ausdruck verleihen. Das lehrt uns auch die Geschichte.
Die Linke tut sich damit schwer, eine EU-kritische und zugleich pro-europäische Position als überzeugende Alternative unter die Leute zu bringen. In Deutschland etwa betonen Teile der Linken die Natur der EU als neoliberal, militaristisch und undemokratisch, während die andere versuchte, eine zu rettende Idee Europas von der real existierenden EU abzuheben.
Ich würde nicht abstreiten, dass die EU eine kapitalistische und imperialistische Konstruktion ist. Nur: Wo ist denn, in unserer Welt heute, eine Regierung, eine staatliche Institution, die keine kapitalistische und imperialistische Konstruktion wäre? Von welchem Standpunkt wird denn diese Kritik formuliert? Heißt das, dass der Nationalstaat in seiner derzeitigen Form weniger imperialistisch oder weniger ein Werkzeug der kapitalistischen Globalisierung als die EU wäre? Oder ist es von einer Warte aus gesprochen, die eine utopische, ganz andere Regierung herbeisehnt? Wenn ersteres der Fall ist, dann weise ich das vollkommen zurück. Ich sehe keinen Grund, warum wir die Nationalstaaten heute Europa vorziehen sollten, und ich sehe nicht, wie sie weniger vom globalen Finanzkapitalismus abhängig sein könnten, als die EU, vielleicht sogar eher mehr. Wenn zweiteres der Fall ist: Ja, ich verteidige die Idee, dass wir für radikale Veränderung eintreten müssen. Meine Position ist, dass wir auf allen Ebenen für diese Alternativen, diese revolutionäre Veränderung arbeiten müssen. Wenn wir die Idee aufgeben, dass die Alternativen nicht nur im Nationalstaat, sondern auch auf der transnationalen Ebene Europas realisiert werden sollen, dann begeben wir uns von Anfang an - angesichts der derzeitigen Herausforderungen - in eine Position absoluter Schwäche.
Das heißt, Europa ist für Sie noch zu retten?
Es ist fundamental für die Linke in Europa, nicht nur dem anti-europäischen Ressentiment zu widerstehen, sondern darüber hinaus konstruktiv zu sein, alternative Visionen und Vorschläge hervorzubringen, so kohärent und konsistent das eben möglich ist. Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich mich freue, dass der Sprecher von Syriza, Alexis Tsipras, bei den EU Wahlen zumindest symbolisch als Spitzenkandidat der Europäischen Linken für die Präsidentschaft der Europäischen Kommission kandidiert: Radikal kritisch dem gegenüber, was die EU als Maschine der neoliberalen Strukturanpassung anrichtet, aber zugleich mit der Forderung nach politischen und institutionellen Veränderungen der europäischen Konstruktion, und nicht ihrer bloßen Auflösung oder Zerschlagung.
Was halten Sie von Vorschlägen, die EU wieder zurückzubauen, gar den Euro zu verlassen?
Ich glaube, dass die europäische Integration zumindest teilweise unumkehrbar ist, wegen der wechselseitigen Abhängigkeiten der verschiedenen Länder, ihrer Gesellschaften und Wirtschaften, weshalb ich sogenannte „souveränistische“, oder nationalistische Positionen für vollkommen abstrakt und ideologisch halte. Andrerseits ist mir natürlich klar, dass die EU als transnationales Gefüge trotzdem auseinanderbrechen kann. Nichts ist in völlig unerschütterlicher Form gebaut. Ich möchte einen Vergleich bemühen, der vielleicht nur auf den ersten Blick lächerlich wirkt, und zwar der zwischen Sowjetunion und Europäischer Union: Die SU und die EU sind nunmal die zwei Beispiele für transnationale Gefüge in Europa, die zu der Geschichte des 20. Jahrhunderts gehören. Beide wurden um ein ökonomisches Dogma herum aufgebaut, das wie ein politischer Mythos funktionierte: Im Fall der SU war das die Planwirtschaft, im Fall der EU ist es das neoliberale Dogma des allmächtigen Marktes ohne Beschränkungen. In beiden Fällen wurde und wird das ökonomische Dogma blind angewandt, was zu krisenhaften politischen Auswirkungen führt. Der Vergleich zeigt, wie schwierig es ist, eine supranationale politische Einheit aufzubauen, und dass, wenn ein zumindest teilweise irreversibler Einigungsprozess einmal vollzogen wurde, ein Kollaps zu katastrophalen Situationen führen kann.
Sie haben vor kurzem in einem Artikel beleuchtet, wie in Europa ein deutscher Hegemon an die Stelle des traditionellen franko-deutschen Gespanns getreten ist, und haben prognostiziert „Es wird für lange Zeit eine deutsche Frage in Europa geben...“
Ja. Sobald ich das geschrieben hatte, dachte ich, ich hätte hinzufügen sollen, und es wird eine französische Frage geben, eine italienische Frage, eine polnische Frage usw. Aber klar, von außen betrachtet, aus dem Süden Europas oder von Frankreichs Warte aus, ist die Hegemonie Deutschlands unverkennbar. Nicht nur, weil wir sehen, wie die französische Regierung mit allen Tricks versucht, entweder die Vormacht Deutschlands auszugleichen, oder wieder in das Führungstandem kooptiert zu werden. Etwa als Hollande versuchte, so was wie ein Gegengewicht in Europa aufzubauen, eine „Latino-Allianz“ mit Italien und Spanien, um zumindest für einen Moment der Sparpolitik zu wiederstehen, was bald gescheitert ist. Die Hegemonie ist also sehr sichtbar.
Eine der Forderungen der Linken wäre die nach einem sozialen Europa, oder einem europäischen Sozialstaat. Davon sind wir derzeit weit entfernt.
Allerdings. Die Idee des europäischen Sozialstaats, oder des „sozialen Europas“ ist seit vielen Jahren Teil der ideologischen Agenda der europäischen Integration, und hat dadurch an Glaubwürdigkeit eingebüßt, dass sich Europa davon entfernt hat, anstatt sie zu verwirklichen. Die Weichen hierfür wurden in den 1970ern und 1980ern gestellt, und am Ende ist von den zwei Säulen der Union (gemeinsame Währung und soziales Europa) nur die gemeinsame Währung übrig geblieben - die uns jetzt alle möglichen Probleme bereitet- , während das „soziale Europa“ im Stadium der Absichtserklärung verblieb. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ein Europa ohne eine soziale Dimension der Wohlfahrt auf europäischem Niveau kollabieren wird. -
Zwei Jahre nach dem Beginn der arabischen Revolutionen wird der Streit der Standpunkte zunehmend gewaltsam ausgetragen: Säkulare Linke und Islamisten, die beiden Hauptakteure des Umsturzes, liefern sich Straßenschlachten in Kairo, während in Tunis gar ein Anführer der linken Volksfront auf offener Straße erschossen wird. In Marokko hingegen koalieren Islamisten und Ex-Kommunisten, und regieren gemeinsam seit über einem Jahr. Ein marokkanischer Sonderweg? Oder ein mögliches Vorbild auch für andere arabische Staaten?
Zuerst erschienen auf ZeitOnline
Abonnieren
Kommentare (Atom)